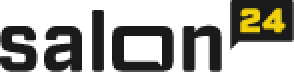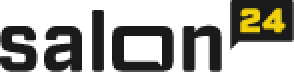Herr Präsident, das Brexit-Votum im Vereinigten Königreich ist ein schwerer Schlag. Beginnt jetzt die Rückabwicklung der EU?
 Autor: Jasper von Altenbockum, Verantwortlicher Redakteur für Innenpolitik. Folgen:
Autor: Jasper von Altenbockum, Verantwortlicher Redakteur für Innenpolitik. Folgen:  Autor: Klaus-Dieter Frankenberger, verantwortlicher Redakteur für Außenpolitik. Folgen:
Autor: Klaus-Dieter Frankenberger, verantwortlicher Redakteur für Außenpolitik. Folgen:
Nein. Ich glaube, dass die 27 zusammenrücken werden. Dennoch ist die Situation schwierig und gefährlich.
Gefährlich? Fürchten Sie Nachahmer?
Zur allgemeinen Überraschung ist in den Ländern, in denen es Nachahmungsbefürchtungen gab, plötzlich die Zustimmung zur EU gestiegen, etwa in Dänemark.
Zeigt sich hier ein Abschreckungseffekt?
Das könnte so sein. Wenn die Leute sehen, welche Risiken es mit sich bringt, den größten Wirtschaftsraum der Welt zu verlassen, werden sie vorsichtiger. Dennoch müssen wir nüchtern feststellen: Großbritannien ist ein G-7-Staat, die zweitgrößte Volkswirtschaft in Europa und ständiges Mitglied im UN-Sicherheitsrat. Ohne Britannien ist die EU schwächer. Umgekehrt muss man fragen: Warum ist es ein G-7-Staat und die zweitgrößte Volkswirtschaft in Europa? Weil es ungehinderten Zugang zum europäischen Markt hat und auf dieser Basis weltweit Handel treibt. Der Brexit bedeutet: Wir alle verlieren!
Was ist denn Ihre Analyse der Motive der Brexit-Wähler?
Viele Dinge spielten da mit. Großbritannien ist nie vollständig integriertes Mitglied der EU gewesen; die Briten wollten das einfach nicht. Dann gibt es eine tiefe Entfremdung eines Teils der Bevölkerung gegenüber Kontinentaleuropa, das mit dem Brüsseler Europa gleichgesetzt wird. Und wir haben bestimmte Entwicklungen einfach unterschätzt. Die Interpretation jedoch, die Bürokratie in Brüssel sei daran schuld, dass die Leute für den Brexit gestimmt haben, halte ich für falsch. Für den Brexit haben Leute aus unterschiedlichen Gründen gestimmt.
Mehr zum Thema
Wähler, die wütend sind, die genug haben von Globalisierung, EU und Arbeitnehmerfreizügigkeit. Was folgt politisch daraus?
Sie haben recht. Ein großer Teil dieser Wutausbrüche und der allgemeinen Verunsicherung hängt mit der Globalisierung zusammen. Die Konsequenz? Wir brauchen einen Dreiklang im Erklären und im Handeln. Erstens: Wir müssen den Leuten offen sagen, dass die Globalisierung nun mal existiert und dass diejenigen, die ihnen erzählen, man könne sie durch Renationalisierung aufhalten, nicht die Wahrheit sagen. Zweitens: Die Globalisierung bringt Vorteile und Risiken; das muss man offen ansprechen. Drittens: Die breite Mitte unserer Gesellschaften, ob in Deutschland, Großbritannien oder Italien, fühlt sich bedroht; diese Bedrohungen sind real. Derjenige, der diese Bedrohung ausspricht, wird deswegen nicht gleich zum Antieuropäer oder Globalisierungsgegner, sondern trägt nur berechtigte Sorgen vor. Er hat Anspruch darauf, dass die Politiker ihn ernst nehmen und Vorschläge machen, wie man damit fertig werden kann. Europa kann ein Instrument zur Lösung sein. Viele Menschen aber glauben, Europa sei die Ursache. Die müssen wir davon überzeugen, dass es ein Mittel zur Bewältigung der Probleme ist.
Drastisch formuliert: Viele Leute haben zwar die Schnauze voll von „mehr Europa“, aber die Therapie lautet „mehr Europa“?
Die Leute haben nicht die Schnauze voll von „mehr Europa“, sie haben die Schnauze voll von diesem Europa. Ich glaube, die Leute wollen ein anderes Europa. Eine kleine Minderheit sind Nationalisten, die große Mehrheit hält die Kooperation von Nationen und Staaten, über Grenzen hinweg, für sinnvoll.
Einen europäischen Staat wollen die Leute aber nicht.