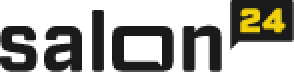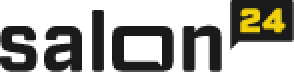© dpa, Deutsche Welle Was macht man mit einem bedingungslosen Grundeinkommen?
Atkinsons Buch gliedert sich in drei Abschnitte: Diagnose, Reformvorschläge, Machbarkeitsstudie. Im ersten Teil unterscheidet Atkinson zunächst Formen der Ungleichheit. Er argumentiert, dass Chancengleichheit wichtig, aber nicht allein entscheidend ist. Denn zum einen könne jemand durch Unglück in Not geraten. Zum anderen unterschieden sich zwar die Talente der Menschen, aber ob ein siegreicher Athlet eine Girlande oder, wie der Gewinner der U.S. Open, drei Millionen Dollar erhält, hänge von ökonomischen Strukturen ab. Mit Blick auf die historische Entwicklung argumentiert Atkinson, dass Umverteilung allein nicht ausreicht, um Ungleichheit zu bekämpfen. Die Verteilung der Brutto-Einkommen, die der Markt bestimmt, sei wichtig. Den Markt aber, so Atkinsons These, können wir beeinflussen.
Reform des Erbrechts
Diese Überlegung bildet den Ausgangspunkt des zweiten Abschnitts, in dem Atkinson fünfzehn konkrete Reformvorschläge sowie einige Ideen zum weiteren Nachdenken formuliert. Auf die technologische Entwicklung etwa könne der Staat Einfluss nehmen, indem er Richtlinien erlasse und bestimmte Forschungsprojekte fördere. Atkinson verlangt, die sozialen Folgen neuer Technologien in den Blick zu nehmen und stärker zwischen ökonomischer Effizienz und gesellschaftlichen Bedürfnissen abzuwägen. Es dürfe nicht sein, dass wenige über Automatisierungsprozesse entscheiden, die vielen die Arbeit nehmen. Aus gesellschaftlicher Sicht könne es mitunter sinnvoll sein, in die Fähigkeiten der Menschen statt in teure, vollautomatische Maschinen zu investieren.
Eine grundlegende Reform des Erbrechts ist ein zweiter zentraler Vorschlag. Da Vermögen heute schneller als Einkommen wachsen und Familien weniger Kinder haben, nimmt die Bedeutung der Erbschaften für das erwartete Lebenseinkommen zu. Um ungleichen Startbedingungen entgegenzuwirken, fordert Atkinson eine progressive Steuer auf Schenkungen und Erbschaften. Zudem schlägt er eine Kapitalausstattung vor, eine Art Minierbschaft, die der Staat jedem Bürger bei Erreichen der Volljährigkeit auszahlt.
Kostenneutral soll es sein
Im dritten Abschnitt antizipiert Atkinson mögliche Einwände. Der wichtigste: Die Maßnahmen seien unbezahlbar und hätten verheerende wirtschaftliche Folgen. Dem hält Atkinson Argumente und Beispielrechnungen entgegen. In einer detaillierten Analyse untersucht er die Finanzierbarkeit eines Partizipationseinkommens, eines Grundeinkommens, das jeder erhält, der sich gesellschaftlich engagieren, sei es in Form von Arbeit, Pflege oder zivilem Engagement. Anders als viele Verfechter eines bedingungslosen Grundeinkommens sieht Atkinson darin eine Ergänzung zum bestehenden Sozialsystem und schlägt mit rund dreihundert Euro pro Monat eine recht moderate Summe vor. In Kombination mit einer Erhöhung der Einkommenssteuer auf in der Spitze 65 Prozent (aber mit Freibeträgen für Einkommen aus Arbeit) und der Einführung eines substantiellen Kindergelds (das jedoch als Einkommen besteuert wird), ließe sich ein solches Grundeinkommen nach Atkinsons Berechnungen in Großbritannien kostenneutral einführen. Eine solche Reform würde gleichwohl zu massiven Einkommensverschiebungen führen.
Atkinsons Überlegungen und Vorschläge beziehen sich auf Großbritannien. Auf andere Länder lässt sich seine Analyse übertragen, jedoch nur mit Einschränkungen. Denn zwar gab es im Westen um 1980 allgemein einen „Inequality Turn“, doch jedes Land hat seine Eigenheiten. Einkommen und Vermögen sind in Großbritannien ungleicher verteilt als etwa in Deutschland, vor allem aber hat die Einkommensungleichheit dort viel stärker zugenommen. Auch strukturelle Unterschiede sind wichtig. Deutschland garantiert Arbeitnehmern umfangreichere Rechte, hat stärkere Gewerkschaften und mehr Industrie. Zugleich ist die deutsche Gesellschaft im europäischen Vergleich aber besonders statisch. Bildungsniveau und Vermögen der Eltern bestimmen die Perspektiven der Kinder stärker als anderswo – und stärker als in der Vergangenheit.
Mehr zum Thema
Die von Atkinson vorgeschlagene Mindesterbschaft, die jeder Bürger bei Erreichen der Volljährigkeit erhält, würde jungen Menschen zu Beginn der Berufslaufbahn zwar ein Stück Freiheit geben. Aber der Ausbau staatlicher Förderprogramme im Bildungsbereich scheint noch dringlicher. Und auch kleine Maßnahmen, etwa die Vergütung von Praktika bei staatlichen Einrichtungen, könnten die soziale Mobilität erhöhen. In Großbritannien ist eine solche Bezahlung längst üblich, damit junge Menschen unabhängig vom Vermögen ihrer Eltern erste Berufserfahrungen sammeln können.
Atkinson hat ein bemerkenswertes Buch geschrieben. Es ist allgemeinverständlich, sachlich fundiert und voll origineller Ideen. Die Motivation, das spürt der Leser immer wieder, ist eine tiefe Sorge. In der zunehmenden Ungleichheit sieht Atkinson nicht nur ein inhärentes Übel, sondern auch eine Gefahr für den sozialen Zusammenhalt und eine funktionierende Demokratie. Zugleich schreibt Atkinson gegen ein Gefühl der Alternativlosigkeit an. Sein Buch ist ein Appell, einen Schritt zurückzutreten und grundlegende politische Fragen neu zu stellen. Man muss nicht jedem seiner Vorschläge zustimmen, um dieses Buch zu schätzen. Lesen sollte man es auf jeden Fall.